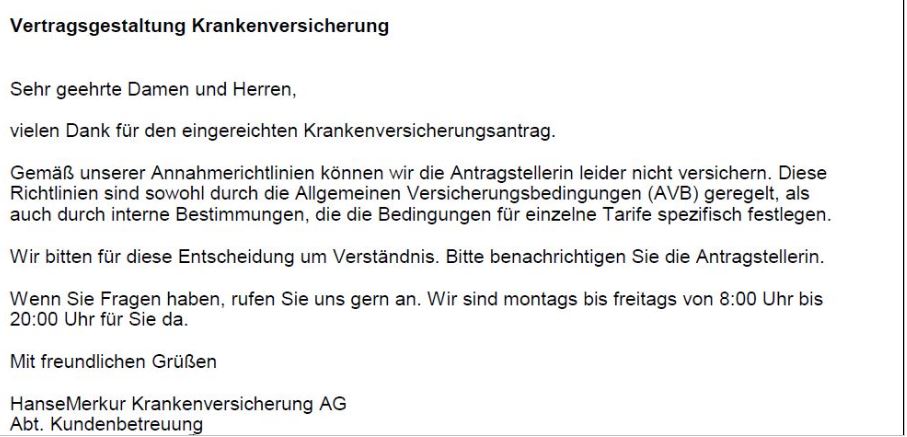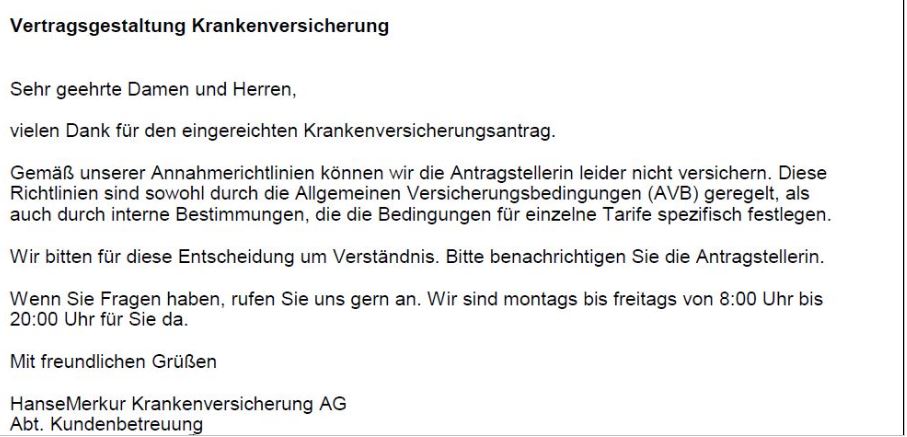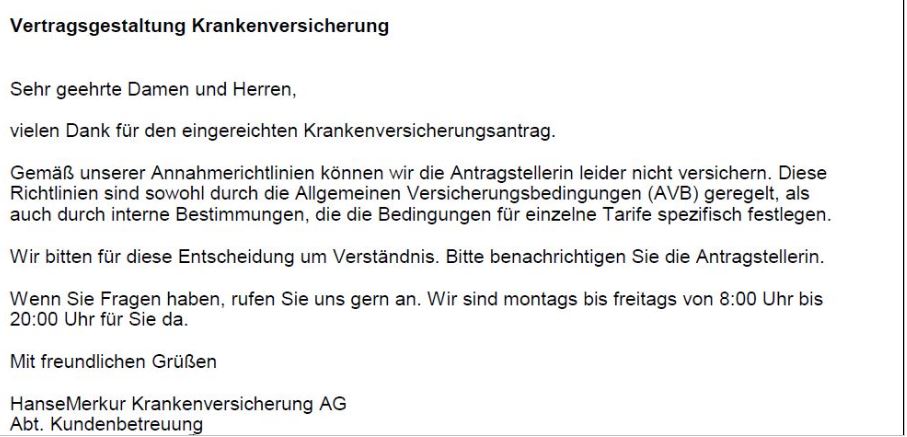Als selbstständige Sexarbeiterin ist es mir wichtig, für Verdienstausfälle im Fall einer länger andauernden Krankheit vorzusorgen und im Notfall Krankentagegeld erhalten zu können.
Deshalb entschied ich mich, zusätzlich zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung, monatlich Geld in eine private Krankenversicherung zu investieren.
Ich ließ meinen Versicherungsmakler nach guten Angeboten suchen und er fand ein solches bei der Hanse Merkur, einer Hamburger Versicherungsgruppe. Erst mal war das: Kein Problem. Weder in den Versicherungsbedingungen noch im Antragsformular fand ich irgendeinen Hinweis, der mir zu denken gab. Im Antrag wurden viele Angaben zu meiner Person abgefragt — also zum Beispiel Vorerkrankungen, erfolgte Operationen und natürlich: Meine berufliche Tätigkeit. Ich nannte wahrheitsgemäß “Erotikdienstleisterin” als meine Berufsbezeichnung.
Spoiler Alarm: Die Ehrlichkeit lohnte sich nicht. Kurz darauf erfuhr ich nämlich von meinem Versicherungsmakler, dass mein Antrag aus einem Grund abgelehnt wurde: Weil ich Sexarbeiterin bin.
Konkret wurde die Ablehnung in einer ersten E‑Mail mit meiner “Tätigkeit im amourösen Gewerbe” und einem Hinweis auf die Annahmerichtlinien begründet (Screenshots von einer Mail an meinem Makler, dem offiziellen Ablehnungsbescheid sowie den Richtlinien seht ihr unter dem Text).
Nachdem der erste Ärger verdaut war, wollte ich es genauer wissen und machte mich auf die Suche nach den Richtlinien, die mir anscheinend den Abschluss einer Vorsorge verunmöglichen. Auf der Homepage der Hanse Merkur waren diese unauffindbar, doch ich fand das mit 2012 datierte Dokument dann trotzdem im Internet. Es scheint noch in dieser Form in Verwendung zu sein, denn tatsächlich sind dort unter Punkt 2: “Personen im amourösen Gewerbe” als “nicht versicherungsfähig” aufgelistet.
Meine Arbeit, innerhalb derer ich Kund:innen in Hotels treffe oder in einer privaten Wohnung empfange, wird also mit der Arbeit in Berufen gleichgesetzt, wo Ausübende hohen Risiken ausgesetzt sind. Zum Beispiel in Steinbrüchen tätige Personen, Akrobat:innen, Seeleute oder Berufssportler:innen.
Diese Einschätzung meines Arbeitsrisikos – des Risikos einer selbstständigen und unabhängig arbeitenden Sexarbeiterin — kann ich nicht nachvollziehen. Ich schätze meine Tätigkeit ähnlich riskant ein wie jene von Kosmetiker:innen oder Physiotherapeut:innen die Hausbesuche machen, oder (wenn ich die möglichen mentalen Belastungen mitdenke) der von Psychotherapeut:innen.
Die Richtlinien lassen maximal unklar, wer unter diese “Personen im amourösen Gewerbe” fällt. Wie sie identifiziert werden. Welche Tätigkeiten sie in welcher Arbeitsumgebung ausüben.
Kurz: Es wird in den Richtlinien nicht nachvollziehbar gemacht, warum diese nicht näher spezifizierte Gruppe von Personen angeblich ein so überdurchschnittliches Risiko bei der Berufsausübung erlebt, dass sie ein ebensolches für die Versicherung darstellt.
Darüber, wie das “amouröse Gewerbe” in den Hochrisikogruppen der HanseMerkur landete, kann ich nur spekulieren.
Wird jeglicher Beruf mit Erotikbezug mit kriminellen Strukturen in Zusammenhang gebracht? Werden Straftaten mit Sexarbeit gleichgesetzt? Wird gefürchtet, dass Sexarbeiter:innen öfter in Konflikte geraten, oder Gefahr laufen, angeschossen oder niedergestochen werden? Schreibt man ihnen einen Hang zum Drogen- und Alkoholmissbrauch zu?
Mir wurde jedenfalls auch auf Nachfrage nicht erklärt, worin das besondere Risiko bei meinem Beruf bestehen soll. Mein Antrag wurde ohne jegliche Nachfrage nach meiner Arbeitsweise und genauerer Tätigkeitsbeschreibung, ausschließlich aufgrund meiner Berufsbezeichnung als Erotikdienstleisterin abgelehnt.
Ich wurde nur darauf hingewiesen, dass man sich auf interne Bestimmungen bezieht und man als Versicherer für sich festlegen kann, wen man unter welchen Voraussetzungen versichern möchte. Es handle sich nicht um Diskriminierung, denn es würden auch ganz andere Berufsgruppen, wie beispielsweise Piloten, abgelehnt.
Fair enough, aber: Dass Berufsgruppen wie Pilot:innen nicht versichert werden, wird bereits im Antragsformular sowie auch in den Versicherungsbedingungen transparent gemacht.
Ganz anders bei den “Personen im amourösen Gewerbe”, wo sich die Versicherung offenbar mit Erklärungen lieber bedeckt hält und bei Nachfrage mit Vertragsfreiheit argumentiert.
Solche Richtlinien – zu mindestens in ihrer derzeitigen generalisierenden Form — die sich offenbar auf jede Form und jeden Arbeitsbereich von Sexarbeit beziehen, stigmatisieren und diskriminieren eine ganze Berufsgruppe. Eine Berufsgruppe, wie sie diverser und heterogener nicht sein könnte.
Von einer Versicherung mit Sitz in Hamburg – eine Stadt, die wie keine zweite von Sexarbeitenden profitiert – habe ich mehr Fähigkeit zur Differenzierung erwartet. Ich weiß nicht, wie es zu den Richtlinien kam – doch ich kann mir sehr gut denken, welches Bild von Sexarbeit ihnen offensichtlich zu Grunde liegt.
Dieses scheint sich eher aus dem Konsum von “Tatort”-Folgen als aus einem realistischen Verständnis der Sexarbeit in Deutschland zu speisen – sehr schade!
Dieser Erfahrungsbericht stammt von Lydia, BesD-Mitglied und Sexarbeiterin aus Leipzig.
Screenshots: